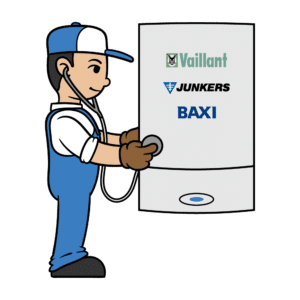- kontakt@installateurmax.at

Ihr Installateur Notdienst 1140 Wien Penzing
heißt Installateurmax
Das Handwerk der Installateure umfasste bis vor wenigen Jahrzehnten nur die Gasversorgung, Trinkwasser und Abwasser. Scherzhaft wurden alle Mitglieder dieser Profession als Fachleute für ‚Gas, Wasser und Scheiße‘ bezeichnet. Die Welt war einfach. Für einen Installateur 1140 Wien stellt sich die Situation in der modernen Zeit jedoch wesentlich komplexer dar.
Oberflächlich gesehen wurde der Aufgabenbereich um das Gebiet ‚Klima‘ erweitert. Ein Blick unter die Motorhaube offenbart allerdings eine Entwicklung auf technischer, aber auch gesetzlicher Grundlage sowie auf Basis kultureller Modeerscheinungen. Kein Witz. Tagsüber sind diese Aufgabengebiete klar, in der Nacht gibt es auch den Installateur Notdienst 1140 Wien, welcher 24 Stunden am Tag für Sie im Einsatz ist!
Inhaltsverzeichnis
Was wir für Sie im Wiener Gemeindebezirk Penzing tun können



Warum der Bereich Klima zum Beruf des Installateurs gehört
Häuser, die bis Mitte des 20. Jahrhunderts gebaut wurden, waren so gut wie gar nicht gegen Kälte isoliert. Die Isolationswirkung der Baumaterialien wurde zunächst für ausreichend gehalten. Wenn durch Ritzen am Rollladenkasten oder Fensterrahmen, an der Tür oder durch die Lücke zwischen zwei Betonfertigteilen die Luft zirkulierte, wurde eben im Winter die Heizung etwas höher gestellt.
Mit den ersten Energiekrisen in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entstand ein Bewusstsein für energieeffiziente Bauweise. Kältebrücken, durch die der Wind pfeifen konnte, wurden abgedichtet. Fenster und Fensterrahmen im Verbund mussten einen bestimmten Wärme-Dämmwert erreichen. Häuser wurden zu echten Bollwerken gegen niedrige Außentemperaturen und zeigten auch bald Vorteile im Sommer, wenn es draußen heiß war, drinnen aber kühl blieb.
Diese Entwicklung – so positiv sie zwar scheint – bringt auch Nachteile mit sich. Je mehr ein Wohngebäude sich einem hermetisch abgeriegelten System annähert, desto schneller sammelt sich auch Feuchtigkeit, die wiederum vermehrt für Schimmelbildung sorgt. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern kann bei Sporenbildung schwere gesundheitliche Folgen haben. Bewohner einer schimmelanfälligen Wohnung wissen, dass die Räume regelmäßig gründlich durchgelüftet werden müssen, um alle Feuchtigkeit loszuwerden. Im Winter bedeutet dies, die für teures Geld aufgewärmte Luft ins Freie zu blasen, und gegen kalte Luft von außen auszutauschen. Ein wahres Dilemma!
Moderne Gebäude zeichnen sich daher durch eine aktive Belüftung aus. Gesondert verlegte Belüftungskanäle bringen gleichmäßig frische, trockene Luft von draußen nach drinnen, während am anderen Ende verbrauchte und vor allem feuchte Luft nach außen abgegeben wird. Über Wärmetauscher kann überdies ein Teil der Wärmeenergie, die in der Abluft steckt, zur Beheizung der Zuluft verwendet werden, um die Energiebilanz noch weiter zu verbessern. In der letzten technischen Ausbaustufe sind solche Systeme in der Lage, nicht nur die Wärmeenergie zurückzugewinnen, sondern auch umgekehrt im Sommer die niedrige Temperatur der Abluft zu nutzen, um damit die Zuluft vorzukühlen. Während es in Österreich selten vorkommt, ist es in anderen Ländern – zum Beispiel den USA – völlig normal, dass ein privates Haus durch eine aktive Kälteanlage gekühlt wird. Für den Mitteleuropäischen Geschmack gilt eine Klimaanlage für private Häuser dagegen immer noch als Energieverschwendung.
Durch diese Kombination aus technischer Weiterentwicklung, Politik und Kultur hat sich der Klimabereich als untrennbar vom Heizen gezeigt, und damit als viertes Standbein für die Installateure etabliert. Praktischerweise wurde der Bereich Wasser und Abwasser zu ‚Sanitär‘ zusammengefasst, so dass der Installateur 1140 Wien Penzing gemeinhin als Fachmann für S, H, K gilt, also Sanitär, Heizung und Klima.

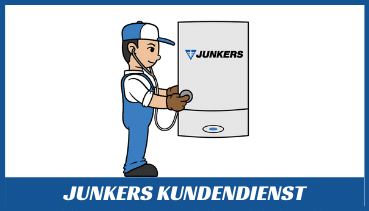
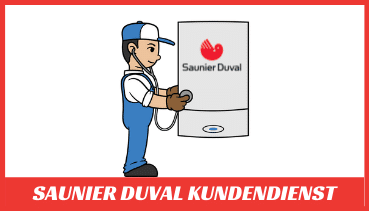



Der Installateur 1140 Wien – oder doch nur für Notfälle?
Nachdem wir nun erfahren haben, dass der Installateur 1140 Wien dafür sorgt, dass ein Wohngebäude sorgsam mit Energie und mit der Gesundheit der Bewohner umgeht, müssen wir uns die Frage stellen, warum wir erst dann über diesen Beruf nachdenken, wenn wir im 14.Bezirk in der Klemme stecken – wenn eine Abflussverstopfung passiert oder ein Wasserrohr leckt, wenn die Heizung kalt ist oder die Luft nach Gas riecht.
Grundsätzlich ist der Anruf bei einem Installateur Notdienst 1140 Wien in jeder dieser genannten Situationen sinnvoll, doch sind vorher einige grundsätzliche Dinge zu tun, die dabei helfen, größere Schäden zu verhindern, und im besten Fall sogar den Einsatz des Installateurs überflüssig zu machen. Das spart natürlich bares Geld.
Bei Gas: Haupthahn zu und Fenster auf in 1140 Wien
Jede Wohnung oder jedes Stockwerk eines Hauses hat einen separaten Zugang für die Gasversorgung, die mit einem Hahn geschlossen werden kann. Drehen Sie diesen Hahn fest zu. Falls Sie noch andere Absperrhähne finden, sind diese ebenfalls zu schließen.
Um zu verhindern, dass sich bereits ausgetretenes Gas irgendwo sammelt, müssen als nächstes alle Fenster geöffnet werden, damit die Wohnräume gut mit frischer Luft durchzogen werden.
Um jedes Risiko auszuschließen, müssen offene Flammen und Funken vermieden werden. Das heißt, Herd, Kerzen, Lampen und Zigaretten müssen aus bleiben, elektrische Geräte sind ebenfalls abzuschalten, übrigens auch Telefon, Klingel oder Lichtschalter.
Rufen Sie dann den Installateurmax an – Sie bekommen rasch einen Installateur Notdienst 1140 Wien geschickt.
Bei Wasser: Haupthahn zu und aufwischen im 14.Bezirk
Auch bei einem Wasserleck gilt die erste Regel: Haupthahn zudrehen! Auch alle anderen Hähne schließen! Tropfendes Wasser mit einem Gefäß auffangen, Eimer oder Schüssel sind ok. Wasserlachen auf dem Boden aufwischen, bevor Teppiche, Parkett oder Möbel ruiniert werden.
Es gibt die Möglichkeit, dass Sie den Schaden selber beheben können. Wenn das Wassergebrechen an einer Stelle aufgetaucht ist, die Sie selbst installiert haben – zum Beispiel am Druckschlauch von der Waschmaschine – dann können sie den Schlauch selber austauschen.
Wenn Wasser von der Decke tropft, kann es auch sein, dass der Schaden in der Wohnung über Ihnen entstanden ist. Seien Sie ein freundlicher Nachbar und weisen Sie die Bewohner darauf hin, vielleicht wissen die noch gar nichts davon. Vielleicht sind sie verreist – dann allerdings sollten Sie die Feuerwehr rufen.
Wenn all das getan ist, aber das Problem besteht immer noch, bleibt der Anruf beim Installateurmax, der Installateur Notdienst 1140 Wien ist dann ruck-zuck bei Ihnen.
Lüftung und Klima in Penzing
Klimageräte sind nur etwas für Fachleute. Wenn aber die Lüftung nicht funktioniert, dann können Sie zumindest zwei Kleinigkeiten prüfen. Schauen Sie nach den Sicherungen, sollte sich überhaupt nichts rühren – und prüfen Sie die Filter, wenn die Lüftung läuft, aber wenig Luft bewegt wird.
Haben sich beide Varianten als ergebnislos gezeigt, hilft immer noch der Installateurmax.
Sie benötigen einen Heizung Notdienst in 1140 Wien

Auch Heizungen haben elektrische Komponenten, zum Beispiel Pumpen oder Ventile. Wenn die ausfallen, dann läuft auch die Heizung nicht. Hier können Sie ebenfalls mal nach den Sicherungen sehen. Vielleicht haben Sie die Heizung selber ganz rasch wieder zum laufen gebracht. Manche Gas-, und viele Ölheizungen kann man ganz ausschalten und wieder neu starten, schon ist das Problem gelöst.
Gasthermen müssen jedes Jahr einer Thermenwartung unterzogen werden, ganz gleich ob Baxi, Junkers oder Vaillant. Wenn doch etwas ausfällt, können Sie nicht viel machen. Rufen Sie den Installateurmax an – der hilft. Thermennotdienst gehört zum Bereich des Installateurs.
Übrigens sollten Sie sich überlegen, ob Sie die Zeit bis zum nächsten Werktag überbrücken können, mit dicken Socken oder Heizdecke, wenn das keine Schwierigkeiten macht. Nachts oder am Wochenende wird der Installateur Notdienst 1140 Wien einen Zuschlag berechnen, den Sie sich so vielleicht sparen können.
Ihr Abfluss macht Probleme in Penzing?

Der Abfluss hat zwei Lösungen. Die eine ist einfach – Sie reinigen ihn selber mit Abflussreiniger und Saugglocke. Die andere nicht – dann ist Ihnen die Reinigung nicht gelungen. Also bleibt wieder der Anruf beim Installateur Notdienst 1140 Wien.
Der Installateurmax für alle Fälle in 1140 Wien
Es muss nicht immer ein Notfall sein in Penzing. Rufen Sie den Installateur für Sanierung, Neubau, Umbau, Austausch und Planung. Mit dem Installateurmax werden Sie immer fachmännisch beraten und bedient.

Sie wohnen nicht im Wiener Gemeindebezirk Penzing?
Sie wohnen nicht im Wiener Gemeindebezirk Penzing? Kein Problem! Installateurmax ist auch in allen Bezirken für Sie im Einsatz. Sehen Sie unterhalb unser Einsatzgebiet für Wien.
Unsere Einsatzgebiete
Vereinbaren Sie einen Rückruf